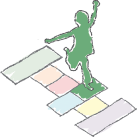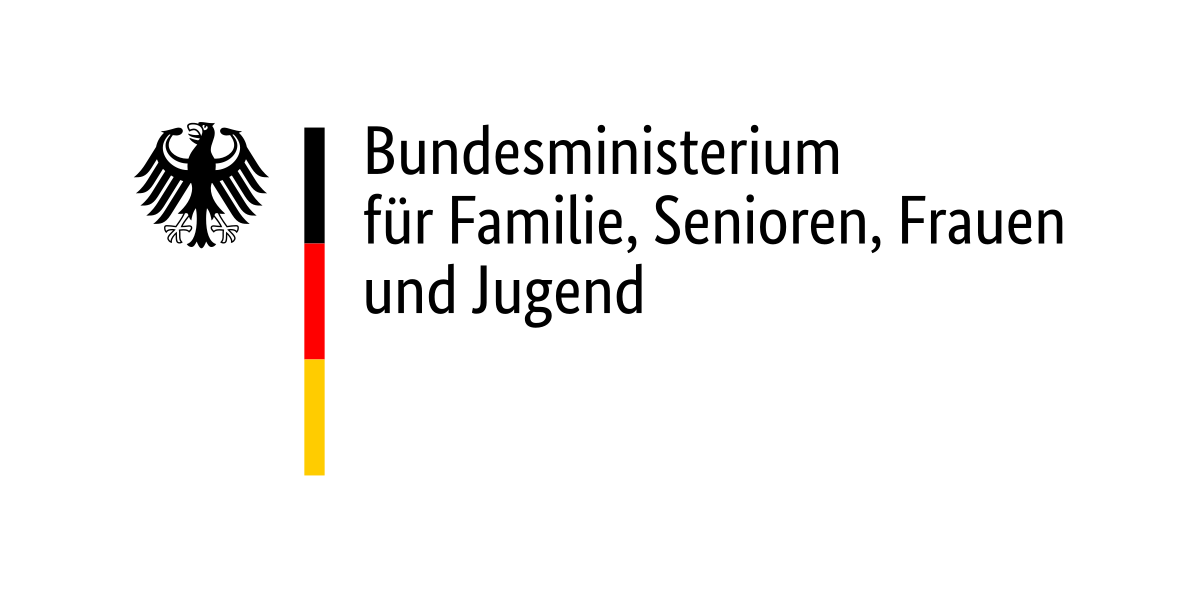Kita-Einstieg – Wissen kompakt
Analphabetismus in Deutschland. Was können pädagogische Fachkräfte beachten?
Andrea Steinke (Mai 2018)
Analphabetismus
Der Begriff Analphabetismus wird vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V. wie folgt differenziert:
• Totaler Analphabetismus: Menschen, die weder schreiben noch lesen können und auch beides nie
gelernt haben.
• Sekundärer Analphabetismus: Menschen, die die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben wieder verlernt haben.
• Funktionaler Analphabetismus: Menschen, die Schrift im Alltag nicht so gebrauchen können wie es im sozialen Kontext als selbstverständlich angesehen wird. Sie können zwar Buchstaben erkennen und sind durchaus in der Lage, Namen oder einzelne Wörter zu lesen und/ oder zu schreiben. Sie können aber den Sinn eines längeren Textes entweder gar nicht verstehen oder nicht schnell und mühelos genug, um praktischen Nutzen davon zu haben.1
Funktionaler Analphabetismus in Deutschland
Rund 7,5 Millionen Menschen in Deutschland sind von funktionalem Analphabetismus betroffen. Das sind etwa 14% der erwerbsfähigen Deutschen. Zwei Millionen können keine vollständigen Sätze und 300.000 Menschen keine einzelnen Wörter
lesen.2
Angst vor Enttarnung
Menschen mit funktionalem Analphabetismus können ausgefeilte Strategien und Methoden entwickeln, um ihre fehlenden Lese- und
Schreibkenntnisse auszugleichen. So lernen sie z. B. sehr viel auswendig oder kooperieren eng mit „Eingeweihten“, um sich auf unumgängliche Situationen vorzubereiten. Wenn Betroffene sich engsten Freundinnen/ Freunden oder Angehörigen anvertrauen und sehr viel Hilfe erhalten, ist das vorübergehend eine gute Bewältigungsstrategie, die jedoch langfristig weitere Ängste und Abhängigkeiten verursacht. Der psychische Druck, der über die Angst vor Stigmatisierung entsteht und der Versuch anonym zu bleiben, bringt viele Menschen mit Analphabetismus in eine gesellschaftliche Isolation.3 Für die pädagogischen Fachkräfte bedeutet das u. a., das Tabuthema „Analphabetismus“ der Eltern als schambesetzte Zugangshürde für eine Anmeldung ihres Kindes in Kindertagespflege und Kita mit im Blick zu haben.
Um Misserfolge und Enttarnung zu vermeiden, nutzen Menschen mit Analphabetismus verschiedene Strategien:
1. Vermeidung von Situationen, in den schriftsprachliches Handeln unausweichlich erscheint.
2. Täuschung, wie z. B. Brille vergessen, Arm gebrochen, Finger verstaucht etc.
3. Delegation wie z. B.: „Mach Du das mal bitte.“, „Das soll lieber jemand anderes erledigen.“
Ursachen von Analphabetismus weltweit
Die Ursachen der verschiedenen Formen von Analphabetismus sind sehr komplex. Häufig spielen schwierige Entwicklungen in der Familie und/ oder im sozialen Umfeld eine entscheidende Rolle: Gleichgültigkeit und Unsicherheit der Bezugspersonen bzw. Vernachlässigung und psychische Belastungen in der Kindheit sind Beispiele für besondere Lebensumstände von Menschen mit Analphabetismus.
Weltweit deckt sich die Landkarte des Analphabetismus mit der Landkarte der Armut. Durch den fehlenden Schulunterricht im Herkunftsland ist der Zugang zur Elementarbildung erschwert. Das gilt vor allem für ländliche Regionen. Allerdings ist dieses Thema in den betroffenen Herkunftsländern häufig weniger stigmatisierend. Dabei ist auch der Anforderungsgrad an schriftsprachliche Kenntnisse meist nicht mit den hierzulande üblichen zu vergleichen.3
Eine Befragung von in Deutschland lebenden Menschen mit Fluchthintergrund aus dem Jahr 2016 ergab, dass sich bei etwa neun Prozent der Interviewten besondere schriftsprachliche Einschränkungen abzeichneten, die auf totalen oder funktionalen Analphabetismus hinweisen könnten.4
Was können Fachkräfte tun, wenn sie Analphabetismus vermuten?
Für den Alltag in der Kindertagesbetreuung oder der Kita kann das u. a. bedeuten, dass Menschen mit funktionalem Analphabetismus zum Beispiel Anträge nicht selbständig ausfüllen können oder dass Elternbriefe und Einladungen nicht verstanden werden.
Bei Familien mit Migrations- und/ oder Fluchthintergrund, die neu in die Kindertagesbetreuung kommen ist zu bedenken, dass eine eingeschränkte Schreib- und Lesefähigkeit auch mit dem Erwerb einer neuen Sprache in Verbindung stehen kann.
Es kann für Menschen mit Analphabetismus sehr hilfreich sein, wenn sie in einem vertrauensvollen Rahmen, wie z. B. in einem Aufnahme- bzw. Elterngespräch wertschätzend und sensibel auf ihre schulische bzw. berufliche Bildung angesprochen werden.
Wenn Fachkräfte später bei Eltern aufmerksam werden, weil eine Mutter beispielsweise immer wieder über Augenprobleme klagt, die Brille verlegt hat oder recht offensichtlich Elternbriefe nicht versteht, dann können Fachkräfte kontinuierlich weiter versuchen, mit viel Feingefühl auf die Betroffenen zuzugehen. Sie könnten zum Beispiel in einem Entwicklungsgespräch über das Kind auf die Leseaktivitäten innerhalb der Familie zu sprechen kommen. Für viele Betroffene ist einer der wichtigsten Schritte, offen über ihr Problem sprechen zu können, ohne eine stigmatisierende Reaktion von ihrem Gegenüber zu erfahren. Wenn sich dann sogar eine Bereitschaft entwickelt, Hilfe anzunehmen, kann die Fachkraft u. a. bei der Suche nach den passenden Hilfeangeboten in der Region unterstützen. Dabei ist zu beachten, dass z. B. bei Elternteilen mit Fluchthintergrund andere und speziellere Förderungen greifen als bei funktionalen Analphabeten, die schon länger in Deutschland leben. Beratung (auch anonym) wird angeboten vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e. V. (www.alphabetisierung.de).
1 Döbert, M. & Hubertus, P. (2000). Ihr Kreuz ist die Schrift. Analphabetismus und Alphabetisierung in Deutschland. Stuttgart: Klett.
2 Grotlüschen, A. & Riekmann, W. (2011). Leo-Level-One Studie. Presseheft. Universität Hamburg. http://blogs.epb.unihamburg.de/leo/ 3
Nickel, S. (2002). Funktionaler Analphabetismus – Ursachen und Lösungsansätze hier und anderswo.
http://alphabetisierung.de/fileadmin/files/Dateien/Downloads_
Texte/Nickel_InternationaleWoche.pdf
4
Brücker, H., Rother, N. & Schupp, J. (Hrsg.). (2018). IAB-BAMFSOEP-Befragung von Geflüchteten 2016: Studiendesign, Feldergebnisse sowie Analysen zu schulischer und beruflicher Qualifikation, Sprachkenntnissen sowie kognitiven Potenzialen. Forschungsbericht 30. Korrigierte Fassung. Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.