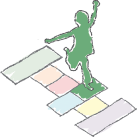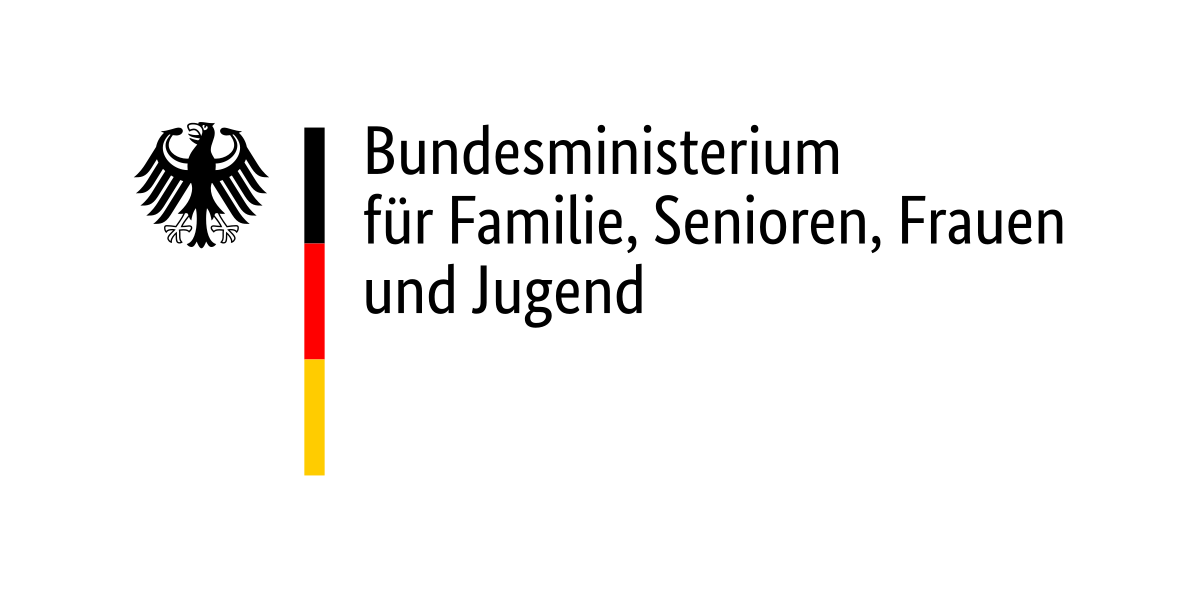Kita-Einstieg – Wissen kompakt
Wie können pädagogische Fachkräfte Familien in Krisen unterstützen?
Andrea Steinke (Mai 2020)
Inhalt: Familiäre Krisen stellen pädagogische Fachkräfte innerhalb des
Bundesprogramms „KitaEinstieg“ vor besondere
Herausforderungen. Es gibt vielfältige Möglichkeiten der Unterstützung, die
individuelle Zugänge zu den Kindern und Familien erforderlich machen.
Was ist eine Krise?
Definitionen von „Krisen“ sind vielschichtig und schwierig, da sie immer auch davon abhängig sind, in welchem Kontext sie formuliert werden. Alltagssprachlich geraten Menschen in eine Krise, wenn sie nicht mehr weiter wissen und ratlos sind. Auch bei schwerwiegenden Themen, wie beispielsweise Krankheit, Tod, Trennung, Flucht und Trauma wird von Krisen gesprochen.1 Das Wort „Krise“ kommt aus dem Griechischen und heißt ursprünglich Entscheidung, entscheidende Wendung. Im Sprachgebrauch ist eine Krise „eine schwierige Situation, Zeit, die den Höhe- und Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt.“2
Krisen sind individuell
Auch innerhalb von Familien werden Krisen von einzelnen Familienmitgliedern unterschiedlich wahrgenommen. Wenn Eltern beispielsweise die Covid-19-Pandemie als eine existientielle Krise erleben, heißt das noch nicht automatisch, dass ihre Kinder die Krise ähnlich massiv beeinflusst. Sie können zwar die Verunsicherungen ihrer Eltern wahrnehmen, sich aber gleichzeitig freuen, dass sie in dieser Zeit besonders viel Zeit mit Mama und Papa verbringen dürfen. Kinder orientieren sich in der gefühlten Einschätzung von Krisen und Bedrohungen stark an den erwachsenen Bindungspersonen. Die Gefühle der Eltern und auch die der pädagogischen Fachkräfte haben Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl der Kinder. Dies gilt umso mehr, je kleiner die Kinder sind und je weniger sie die Zusammenhänge kognitiv verstehen. Von Kind zu Kind können Unsicherheiten bzw. Ängste und die damit einhergehenden Verhaltensänderungen sehr
unterschiedlich sein.3
Umgang mit Familien in Krisenzeiten
Kontinuierlich belastete Familien können in Krisenzeiten regelmäßig auf passende Hilfsangebote außerhalb der Kindertagesbetreuung aufmerksam gemacht werden. Dafür sollten die vorhandenen Netzwerke im Sozialraum genutzt werden. Manchmal ist es erforderlich und sinnvoll, dass die Übergänge in andere Unterstützersysteme und die Kontaktaufnahme der Familien begleitet werden.
Wichtig ist das Bewusstsein der Fachkräfte, dass auch bisher unauffällige Familien unerwartet in Not geraten können.3 Außerdem können Eltern sehr plötzlich und überraschend durch Retraumatisierungen ihre elterlichen Fähigkeiten verlieren, sich in die Gefühle, Nöte, Phantasien und Bedürfnisse ihrer Kinder einzufühlen, was sich besonders auf die Interaktionen mit ihren Babys und Kleinkindern auswirken kann.4 Wenn Fachkräfte dann beispielsweise große Sorgen haben, dass die Versorgung des Kindes nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, geht es darum, mit den Eltern in Kontakt zu treten, um mit ihnen nach Möglichkeiten zur Veränderung zu suchen. Wenn das gar nicht möglich erscheint, benötigen die Fachkräfte weitere Unterstützung, in Form von externer oder kollegialer Fachberatung oder Supervision. Dies ist auch deswegen wichtig, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesprogramms leicht in Gefahr geraten können, gerade in anhaltenden Krisen zu
viel Verantwortung für Familien zu übernehmen. Menschen in Lebenskrisen stehen in der Regel stark unter Druck.5 Dann ist es für die Fachkräfte umso wichtiger, eigene und institutionelle Grenzen zu reflektieren und entsprechend zu handeln.
Reflexionsarbeit zum Thema „Krise“5
Besonders wichtig ist, dass Fachkräfte innerhalb des Bundesprogramms die eigene persönliche Haltung gegenüber der Berufsrolle und der Helferrolle reflektieren. Sie können sich beispielsweise folgende Fragen stellen: Welche Absichten und Motivationen stehen hinter meiner aktuellen Tätigkeit? Welche Grenzen der Interventionsmöglichkeiten habe ich im Zusammenhang mit auftretenden Krisensituationen in meinem Arbeitsbereich bzw. in meinem institutionellen Rahmen? Welche persönlichen Grenzen nehme ich bei mir selbst wahr? Wie viel Verantwortung kann und muss ich für die betroffenen Kinder übernehmen?
Kindertagesbetreuung als Schutzraum
Pädagogische Fachkräfte können damit rechnen, dass Kinder in Krisensituationen den Schutzraum der Kindertagesbetreuung nutzen und ihren Gefühlen wie Angst, Wut und Traurigkeit freien Lauf lassen. Kinder in Krisensituationen können sich aber auch besonders verschlossen zeigen. In diesen Situationen sind neben Zugewandtheit und offenen Gesprächen klare Strukturen, feste Rituale, und kindgerechte Möglichkeiten der freien Entfaltung wie zum Beispiel Bewegungs- und Kreativangebote besonders wichtig. Zentral für die pädagogischen Fachkräfte ist außerdem, immer wieder aktiv den Austausch innerhalb des Teams zu suchen, um mit den eigenen Fragen und Verunsicherungen gut umgehen zu können. Kinder, die in ihrem Wohl gefährdet sind, werden ihr Leid mit größter Wahrscheinlichkeit nur selten offen benennen und stattdessen vor allem non-verbale Signale aussenden oder Auffälligkeiten in ihrem
Verhalten zeigen.3 Wenn ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht, benötigt es spezifische Vorgehensweisen, die einerseits gesetzlich vorgegeben und andererseits in jedem Standort individuell geregelt sind. In einem weiteren Wissen kompakt-Text zum Thema Kinderschutz wird das unter anderem kurz erläutert.
Krise als Chance: Erkunden der Ressourcen
Fachkräfte können gemeinsam mit den
Familienmitgliedern versuchen herauszufinden, welche Ressourcen sie trotz einer Krise im Alltag entdecken und für sich nutzen können. Das kann bewusst geplante Zeit gemeinsam mit den Kindern sein, wie z. B. Bilder malen, die Lieblingsmusik hören oder Spiele spielen. Manchmal benötigen Mütter oder Väter aber auch Zeit für sich alleine. Dann geht es darum gemeinsam zu überlegen, wer außer der Mutter oder dem Vater die Kinder versorgen und betreuen kann, damit Eltern sich regenerieren und stabilisieren können.
Umgang mit akuten Krisen
Es kann auch vorkommen, dass die vorhandenen Krisen in den Gesprächen mit den Eltern einen (zu) großen Raum einnehmen und die Probleme nicht ausreichend gelöst bzw. die Familien (noch) nicht in die passenden Hilfesysteme überwiesen werden konnten. Dann kann es förderlich sein, die Eltern an entsprechende Notfall- bzw. Hilfetelefone zu verweisen, die zum Teil auch mehrsprachige
Beratung anbieten.6;7
1 Alle, F. (2017). Kindeswohlgefährdung. Das Praxishandbuch.
Freiburg: Lambertus.
2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Krise
3 Maywald, J. (2020). Kindeswohlgefährdung in der CoronaKrise. Ein Interview. Kindergarten heute, (5), 14-15. 4 Lennertz, I. & Leuzinger-Bohleber, M. (2020). Traumatisierung von Kindern in Folge von Flucht und Vertreibung. In R. BrachesChyrek et al. (Hrsg.), Handbuch Frühe Kindheit. 2., akt. u. erweit.
Aufl. Berlin: Barbara Budrich.
5 Kunz, S. & Scheuermann, U. & Schürmann, I. (2009). Krisenintervention. Ein fallorientiertes Arbeitsbuch für Praxis und Weiterbildung. Weinheim und München: Juventa 6 https://www.hilfetelefon.de/das-hilfetelefon/beratung/ beratung-in-17-sprachen.html
7 https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/alle-meldungen/nummer-gegen-kummer----telefonische-hilfe-fuer-eltern-undkinder/89948?view=DEFAULT