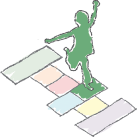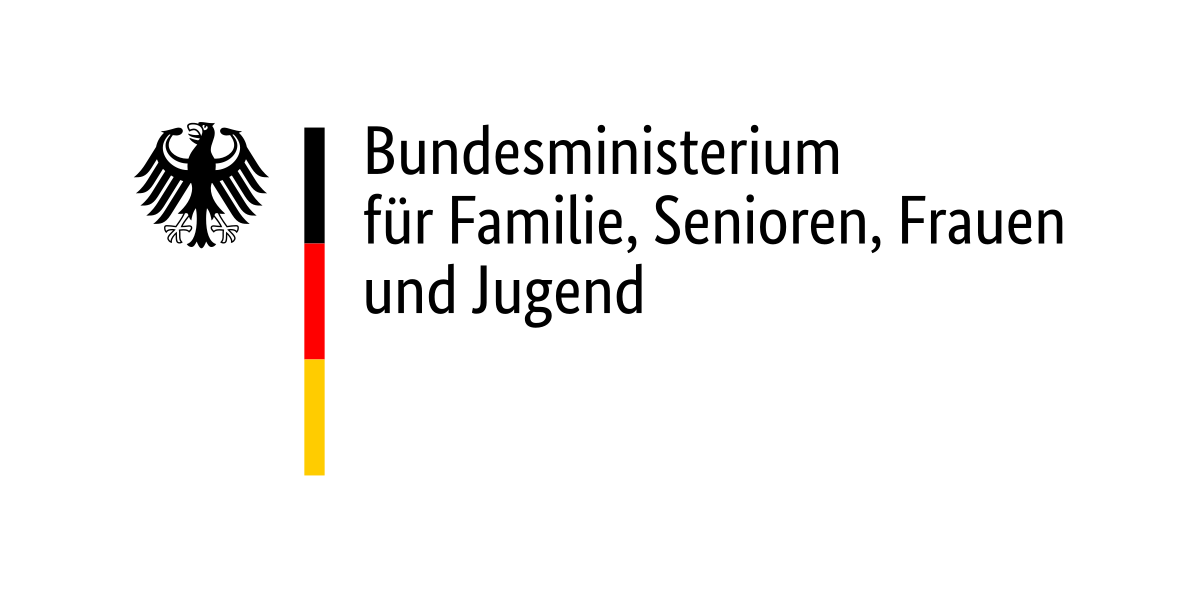Kita-Einstieg – Wissen kompakt
Welche traumapädagogischen Ansätze können für die Arbeit mit
Kindern in der Praxis hilfreich sein?
Andrea Steinke (April 2018)
Inhalt: Der folgende Text beschreibt erste Ansätze traumapädagogischen
Handelns für Fachkräfte in Kindertagespflege und Kita. Dabei wird der Fokus auf
die Begleitung traumatisierter Kinder gelegt und nicht auf die Traumaverarbeitung, die eher im therapeutischen Kontext
verortet ist.
Traumatisierte Kinder fordern pädagogische Fachkräfte oft heraus, sehr genau hinzusehen und entsprechend zu handeln. Hier stellt sich in der Praxis häufig die Frage, wie das Wissen über Ursachen und Folgen von Traumatisierung für die eigene pädagogische Arbeit genutzt werden kann. Traumapädagogische Ansätze beschäftigen sich mit diesen Fragen. Sie sind auch für
Kindertagespflege und Kita bedeutsam. Denn als Orte der täglichen Begleitung von Kindern können Fachkräfte die individuelle Entwicklung positiv beeinflussen und zur Stabilisierung der Kinder und Familien beitragen.
Eine grundlegende Voraussetzung für traumapädagogische Arbeit ist eine allgemeine Grundhaltung, die unter anderem folgende Kennzeichen aufweist:
ü das Verstehen der Überlebensstrategien und das Wissen um Folgen von Traumatisierung und biografischen Belastungen
ü Respekt vor der (Über-)Lebensleistung der
Kinder
ü ein Schwerpunkt auf Ressourcen und Resilienz
ü das Verständnis, dass die gezeigten Verhaltensweisen normale Reaktionen auf eine extreme Stressbelastung sind 1
Jegodtka und Luitjens gehen davon aus, dass die Folgen von Trauma und
Gewalt nicht auf das Individuum beschränkt bleiben, sondern sich auf
verschiedenen Systemebenen manifestieren und entsprechend auf das Individuum
zurückwirken.2
In der Arbeit mit traumatisierten Kindern bedeutet das, ihre evtl. schwierigen Verhaltensweisen im gesamten Kontext des Zusammenspiels von
Familie, Institutionen, Gesellschaft und Kultur zu sehen. Die betroffenen Kinder haben einen guten Grund für ihre Annahmen, Reaktionen und
Verhaltensweisen und sind nicht verantwortlich für das, was ihnen widerfahren ist. Im Gegenteil, sie haben in ihrem Leben schon viel geleistet.
Allgemeine methodische Ansätze traumapädagogischen Handelns:
-Sicherheit und Stabilität herstellen
-Fähigkeit zur Stressregulation durch Entspannungs- und
Aktivierungsmethoden fördern
-Entwicklung von Kontaktfreudigkeit, Beziehungsfähigkeit, sicheren Bindungen durch Interaktions- und Kommunikationsspiele und Beziehungsangebote unterstützen
-positives Selbstbild und eine konsistente Identitätsentwicklung ermöglichen
-Problemlösung, Ressourcenorientierung, Potenziale und einen gesundheitsbewussten Lebensstil fördern
Kindertagespflege und Kita als sicherer Ort
Die Kindertagesbetreuung kann für traumatisierte Kinder ein sicherer Ort sein, in dem die Fachkräfte sie unterstützen, Fähigkeiten und Ressourcen zu entwickeln und aufzubauen. Dabei geht es vor allem um einen Ort, in dem Kindern geholfen werden kann, ihre Beeinträchtigungen zu akzeptieren. Wenn Fachkräfte die Kinder als Expertinnen und Experten für ihr eigenes Leben betrachten, können die Fachkräfte den Kindern ihr Wissen und eine sensible und empathische Haltung zur Verfügung stellen und sie in diesem Raum entsprechend begleiten.
Ein ganz wesentlicher Ansatz einer traumapädagogischen Haltung ist, dass Fachkräfte den Kindern helfen, Vertrauen aufzubauen und sichere Bindungen einzugehen.
Das Zentrum für Traumapädagogik in Hanau benennt wichtige Aspekte für pädagogische Fachkräfte zur Förderung der Selbstregulation bei den Betroffenen: 3
• den physiologischen Auswirkungen von Stress gerecht werden
• Warnsignale, Trigger und Stimuli kennen und identifizieren lernen
• Abreaktion der belastenden Gefühle und der eingefrorenen Energie ermöglichen
• Methoden der Selbstregulation entwickeln
• Körpergewahrsein und Körperfürsorge entwickeln.
•
Klare Regeln und Strukturen
Kinder, die Traumatisches erlebt haben, brauchen verständliche Regeln und Strukturen sowie klare Konsequenzen und Orientierung, damit Vorhersehbarkeit als Erfahrung möglich wird. Verlässliche Tagesabläufe unterstützen dieses Bedürfnis nach Halt.
In einem gut strukturierten Gruppenalltag hilft es den Kindern, wenn sich die Fachkräfte trotz aller Schwierigkeiten immer wieder auf eine wohlwollende und wertschätzende Haltung fokussieren. Wesentlich dabei ist, jedes Kind individuell zu betrachten und die jeweiligen Bedürfnisse und inneren Bilder und Vorstellungen zu differenzieren, um bei der Symptom- und Stressregulation hilfreich sein zu können.
Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung
Bei der Arbeit mit traumatisiserten Kindern ist das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung zusätzlich von zentraler Bedeutung.
Übertragungen sind unbewältigte Beziehungserfahrungen, die in andere Beziehungskontexte hineingetragen werden und den Teufelskreis des Wiederholungszwanges beschreiben. Die meisten traumatisierten Kinder beleben und inszenieren Situationen neu, wenn sie eine unbewusste Erinnerung daran haben. Dann wird die aktuelle Bezugsperson zu einer Reaktion gebracht, die zu der unbewältigten Situation gehört. Sie wird zur Vertreterin oder zum Vertreter der inneren negativ besetzen Figur gemacht. Die Wiederholung des Unglücks, verbunden mit Gefühlen der Angst und Not löst im Gegenüber eine Gegenübertragung aus. Diese kann dann unbewusst dazu führen, dass eine Retraumatisierung des Kindes stattfindet. Es ist wichtig, dass Bezugspersonen von traumatisierten Kindern lernen, diese Situationen zu identifizieren, damit sie feinfühlig auf das Kind reagieren und den unbewussten negativen Wünschen und Rollenerwartungen nicht entsprechen. Regelmäßige Supervisionen helfen den Fachkräften in der Praxis, eigene
Verhaltensweisen und Reaktionen so zu gestalten, dass positive Erfahrungen für jedes Kind individuell möglich sind.4
1 Weiß, W. (2006). Philipp sucht sein Ich. Zum pädagogischen
Umgang mit Traumata in den Erziehungshilfen (3. aktualisierte
Auflage). Weinheim: Juventa
2 Jegodtka, R. & Luitjens, P. (2016). Systemische Traumapädagogik. Traumasensible Begleitung und Beratung in psychosozialen Arbeitsfeldern. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht.
3
Kessler, T. (2015). Flucht und Trauma. Unveröffentlichtes Handout zum Vortrag am 07.12.2015 in Osnabrück.
4
Reekers, H. & Gloger-Wendland, K. (2016). Traumata und ihre
Folgen. Stärkende Ansätze aus der Traumapädagogik. (nifbeThemenheft Nr. 29). Osnabrück. Download: https://www.nifbe
.de/images/nifbe/Infoservice/Downloads/Traumaonline.pdf